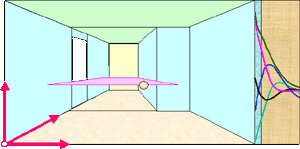Das Buch
Vergleichsprozesse der Klimatechnik
Heidelberg: C. F. Müller 1998, ISBN 3-7880-7643-7
ist vergriffen und wird nicht mehr aufgelegt.
Inhalt und spezielle Anmerkungen:
1. Einleitung
2. Einordnung der Vergleichsprozesse der Klimatechnik
Der wichtigste Kreisprozess der Thermodynamik ist der CARNOT-Prozess. Hierarchisch unter diesem stehen aggregatspezifische Vergleichsprozesse, wie z. B. der JOULE-Prozess für Gasturbinenanlagen.
Vergleichsprozesse zur Luftaufbereitung existierten bisher nicht, sodass Verbesserungen der Regelung von Klimaanlagen nicht auf ihren tatsächlichen Qualitätsstand beurteilt werden konnten.
Während bei den Wärmekraftanlagen die Steigerung des Wirkungsgrades das Hauptziel darstellt, gibt es beim Klimaprozess mehrere sinnvolle Zielstellungen:
- minimaler Betriebskostenaufwand
- minimaler Energieaufwand
- minimale Umweltbelastung
- minimaler Exergieverlust.
Erschwerend sind beim Klimaprozess die zahlreichen Einflussfaktoren:
- Variantenvielfalt der Aggregatereihung
- vielseitige Anforderungen, z. B. Erwärmen, Befeuchten, Kühlen, Entfeuchten
- stark unterschiedliche, wetterabhängige Randbedingungen.
3. Optimierung des klimatechnischen Prozesses
Ausgehend vom Stand der Technik wird eine neue Optimierungsstrategie (dynamische Optimierung mit den Variablen Temperatur und Feuchte) mit einer variabel definierbaren Zielfunktion entwickelt.
Die Algorithmen für ein Optimierungsprogramm werden vorgestellt. Die Ermittlung der Luftzustände basieren auf dem Buch: Stoffwerte
Die Luftzustandsänderungen in den verschiedenen Aggregaten zur Luftbehandlung werden beispielhaft algorithmiert. Sie sind jederzeit noch weiter detaillierbar.
Beispiele demonstrieren die Anwendbarkeit. Hinweise zur erweiterten Anwendbarkeit des Verfahrens werden gegeben.
4. Einflussnahme der Komponentenmodellierung auf das Optimierungsergebnis
Näherungen, adaptive Modellanpassungen und genaue thermodynamische Modellierungen werden vorgestellt. Besondere Beachtung finden Wärmeübertragerschaltungen mit unterschiedlichen Gegenstromanteilen sowie die Modellierung eines Kreislaufverbundes zur Wärmerückgewinnung.
5. Einflussnahme unterschiedlicher Zielfunktionen und Aggregatebestückungen auf das Optimierungsergebnis
Beispielsweise wird die kalorische und exergetische Bewertung der Wärme demonstriert.
6. Vereinfachte Umsetzung der Optimierungsergebnisse
Ein spezieller Exkurs zeigt den Einsatz neuronaler Netze und seine derzeitigen Probleme bei der Nutzung. Weiterhin wird versucht, konventionelle Regelungen einzubeziehen. Vergleichende Betrachtungen erfolgen auf der Basis von Jahressimulationen. Die Kombination von Vergleichsprozess und konventioneller Regelungsstrategie erweist sich als sinnvoll.
7. Meteorologische Daten
Die Gegenüberstellung von Häufigkeiten der bekannten t,x-Korrelationen und der Testreferenzjahr-Daten zeigte Diskrepanzen. Sie sind durch die Neufassung der DIN 4710 jetzt geringer, aber nicht grundsätzlich beseitigt.
8. Schlussfolgerungen mit Extrapolation der Ergebnisse
nach oben